It can take a while depending on the size of the document..please wait
Discuto
0 days left (ends 14 Nov)
description
LATEST ACTIVITY
LEVEL OF AGREEMENT
MOST DISCUSSED PARAGRAPHS
LATEST COMMENTS
MOST ACTIVE USERS

|
 miraconsult e.U. miraconsult e.U. |
47 | 117 |

|
 erwin.bernsteiner@umweltfragen.at erwin.bernsteiner@umweltfragen.at |
47 | 102 |

|
 bh.strasser@aon.at bh.strasser@aon.at |
41 | 87 |
 Holzinger Holzinger |
32 | 117 |

P21
NEU: Externe Dienstleister (nur BEH, TAG und MUS)
Sind am Betriebsstandort externe Dienstleister präsent (z.B. Gastronomiebetriebe), so müssen diese über die Anforderungen des Umweltzeichens informiert und angehalten werden, zumindest die relevanten Muss-Kriterien zu erfüllen. Falls für deren Dienstleistungen eine Zertifizierung mit dem Umweltzeichen möglich ist (z.B. eingemietete Gastronomiebetriebe), ist eine vertragliche Vereinbarung zu treffen, dass die Umsetzung des Umweltzeichens von diesen Betrieben längstens bis zur Folgeprüfung des Antragstellers angestrebt wird. Dies ist auch in dessen Aktionsprogramm festzuhalten.
Add/View comments (7)






P23
NEU: Sozialplan (maximal 2 Punkte)
Der Betrieb muss einen schriftlichen Sozialplan festlegen, um mindestens eine der folgenden Sozialleistungen für die MitarbeiterInnen zu gewährleisten (0,5 Punkte für jede Sozialleistung, maximal 2 Punkte):
a) Freistellung für Bildungsmaßnahmen,
b) kostenlose Mahlzeiten oder Essensgutscheine,
c) kostenlose Uniformen und Arbeitskleidung,
d) Preisnachlass auf Produkte/Leistungen im Beherbergungsbetrieb,
e) finanziell unterstütztes nachhaltiges Verkehrsprogramm,
f) Sicherheiten für Immobilienkredite.
Der schriftliche Sozialplan ist jährlich zu aktualisieren und den MitarbeiterInnen mitzuteilen. Diese müssen den schriftlichen Sozialplan bei der Informationsveranstaltung unterzeichnen. Das Dokument muss an der Rezeption für alle MitarbeiterInnen verfügbar sein.
Add/View comments (12)






P24
Sonstige Anregungen und Kommentare zu den weiteren Soll-Kriterien sowie Anmerkungen zu Kriterien des Kapitels „Management und Kommunikation“
Add/View comment (1)

P26
E 01 Energieausweis oder Energieerhebung
Ein Energieausweis nach OIB 6 muss - entsprechend den gesetzlichen Vorgaben - vorliegen und ggf. durch Vorschläge zu sinnvollen Verbesserungs- oder Sanierungsmaßnahmen ergänzt werden.
Liegt (noch) kein Energieausweis vor, so muss eine längstens drei Jahre vor der Erstantragstellung von einem/einer EnergietechnikerIn/-beraterIn erstellte energetische Erhebung vorliegen (Grobanalyse des energietechnischen Ist-Zustandes des Betriebs, insb. Gebäudehülle und Haustechnik).
Die im Rahmen des Energieausweises bzw. der Energieerhebung vorgeschlagenen Maßnahmen zur energetischen Verbesserung des Betriebes müssen in das Nachhaltigkeitskonzept des Betriebes einfließen.
Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung, reine Catering-Betriebe sowie eingemietete Betriebe mit geringem oder keinem Einfluss auf die haustechnische Ausstattung (z.B. Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung) müssen zumindest eine Erhebung signifikanter, verbrauchsintensiver (Küchen-)Geräte durchführen und deren Verbrauchsdaten (Energie- und Wasserverbrauch) hochrechnen. Geräte mit hohem Einsparpotenzial sind hier besonders zu berücksichtigen und der Ersatz durch hoch effiziente Geräte im Maßnahmenplan festzulegen.
Für Schutzhütten und Privatvermieter ist eine Eigenerhebung inklusive Fotodokumentation möglich.
Add/View comments (2)


P27
E 02 Wärme- und Schalldämmung von Fenstern
90 % der Alle Fenster in beheizten und/oder klimatisierten individuell oder gemeinschaftlich genutzten Räumen mit Heizung und/oder Klimaanlage müssen mindestens mit einer Doppelverglasung oder eine gleichwertige Verglasung ausgestattet sein. je nach örtlichen Vorschriften bzw. gemäß der OIB Richtlinie und den klimatischen Bedingungen eine adäquate Wärmedämmung und darüber hinaus eine angemessene Schalldämmung aufweisen.
Add/View comments (5)




P28
E 03 Wartung von Heizkesseln (gilt nicht für CAT und GEM)
a) Die Heizkessel müssen sachgerecht gewartet werden, wobei die gesetzlichen Vorgaben, die einschlägigen IEC und nationalen Normen bzw. die Anweisungen des Herstellers einzuhalten sind.
b) Einmal jährlich (bzw. bei Kleinstbetrieben und Schutzhütten entsprechend der gesetzlich festgelegten Intervalle) ist zu überprüfen, ob die gesetzlichen oder in den Anweisungen des Herstellers festgelegten Wirkungsgrade eingehalten werden und ob die Emissionen die gesetzlich festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten. Falls die Überprüfungen ergeben sollten, dass die vorstehend genannten Auflagen nicht erfüllt werden, sind unverzüglich Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Add/View comment (1)

P29
E 04 Wirkungsgrad und Wärmeerzeugung Energieeffiziente Geräte für Raumheizung und Warmwasserbereitung (gilt nicht für CAT und GEM)
Der feuerungstechnische Wirkungsgrad von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickten vorhandenen Warmwasserheizkesseln muss mindestens 88% betragen.
Bei Erneuerung oder Tausch der Heizanlage während des Gültigkeitszeitraums des Umweltzeichens muss ggf. ein Sanierungskonzept mit Priorität der Gebäudehülle erstellt und der Einsatz von erneuerbaren Energieträgern geprüft werden. Wenn dieser aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll ist, müssen hocheffiziente Technologien, wie Brennwerttechnologie, 4-Sterne Kessel, effiziente KWK-Anlagen oder Wärmepumpen eingesetzt werden. (Die Anforderungen des EU Ecolabels (Kriterium 6) sind hierbei zu berücksichtigen; sofern vorhanden und für den Einsatzzweck geeignet sind entsprechende Heizkessel mit einem Umweltzeichen nach ISO Typ 1 zu verwenden.)
Alle während des Gültigkeitszeitraums des Umweltzeichens gekauften Anlagen, die als Warmwasser-Zentralheizungen eingesetzt werden können, müssen mit einem Pufferspeicher ausgestattet sein.
Vorhandene KWK-Anlagen müssen der Definition für hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung gemäß Anhang III der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates oder, wenn sie nach dem 4. Dezember 2012 installiert wurden, gemäß Anhang II der Richtlinie 2012/27/EU entsprechen.
Add/View comment (1)

P30
E 05 Wärmedämmung des Heizkessels, der Speicher sowie der Heizungs- und Trinkwasserrohre (gilt nicht für CAT und GEM)
Der Heizkessel, der Warmwasserspeicher sowie die Heizungs- und Trinkwasserrohre in nicht beheizten Räumen des Betriebes müssen zumindest im sichtbaren Bereich wärmegedämmt sein.
Add/View comment (1)

P31
E 06 Klima- und Heizungsgeräte Energieeffiziente Klimageräte und Luft-Wärmepumpen (bei Neuanschaffungen) (gilt nicht für CAT und GEM)
Raumklima- und Heizungsgeräte, die nach Vergabe des Umweltzeichens angeschafft werden, werden so ausgerüstet, dass sie sich bei geöffneten Fenstern selbsttätig ausschalten, wenn die Fenster geöffnet werden oder die Gäste das Zimmer verlassen.
Raumklimageräte und Luft-Wärmepumpen, die während der Gültigkeitsdauer des Umweltzeichens installiert werden, müssen mindestens der Energieeffizienzklasse A für Raumklimageräte[i] entsprechen oder eine gleichwertige Energieeffizienz aufweisen mindestens den folgenden Energieeffizienzklassen entsprechen: Monosplit-Geräte < 3 kW - A+++/A+++; Monosplit-Geräte 3-4 kW - A+++/A+++; Monosplit-Geräte 4-5 kW - A+++/A++; Monosplit-Geräte 5-6 kW - A+++/A+++; Monosplit-Geräte 6-7 kW - A++/A+; Monosplit-Geräte 7-8 kW - A++/A+; Monosplit-Geräte > 8 kW - A++/A++; Multisplit-Geräte - A++/A+;
Anmerkung: Dieses Kriterium gilt für netzbetriebene Klimaanlagen und Luft-Wärmepumpen mit einer Nennleistung von ≤ 12 kW für die Kühlung oder, wenn das Gerät keine Kühlfunktion hat, für die Heizung. Dieses Kriterium gilt nicht für Geräte, die andere Energiequellen als Strom nutzen, und für Geräte, die auf Verflüssigerseite — oder auf Verdampferseite — nicht Luft als Wärmeübertragungsmedium nutzen.
Anmerkung: Dieses Kriterium gilt nicht für Geräte, die entweder auch mit anderen Energiequellen betrieben werden können, oder für Luft-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpen oder Geräte mit einer Leistung (Kühlleistung) von über 12 kW.
In Schutzhütten sind Raumklimageräte generell durch andere geeignete Maßnahmen wie z.B. Abschattungen und Isolierungen zu vermeiden.
Add/View comments (5)





P32
E 07 Keine Kohle, Heizöle Schweröle, Kohlebriketts und Elektrodirektheizung
Als Energiequelle dürfen weder Heizöle Schweröle mit einem Schwefelgehalt von über 0,1 % noch Kohle und Kohlebriketts verwendet werden. Kohle für Feuerstellen zu Dekorationszwecken ist von dieser Bestimmung ausgenommen. Werden Heizöle als Energiequelle verwendet, so ist ein Umstieg auf alternative Energiequellen im Aktionsprogramm festzuhalten.
Ausschließliche Elektrodirektheizung sowie sogenannte „Infrarotheizungen“ ist sind ebenfalls ausgeschlossen, sofern die elektrische Energie nicht aus einem Inselbetrieb aus Wasserkraft oder Windkraft oder zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen stammt.
Dieses Kriterium gilt nur für Betriebe mit einem unabhängigen Heizungssystem.
Add/View comments (3)



P33
E 08 Lagerung von Flüssigbrennstoffen (gilt nur für SCH)
Werden zu Heizzwecken flüssige Brennstoffe verwendet, so müssen Auffangvorrichtungen zur Vermeidung von Bodenverunreinigungen vorhanden sein.
Add comment
P34
NEU: Wärmeregulierung (gilt für BEH, GAS, TAG)
Die Temperatur muss in jedem gemeinschaftlich genutzten Raum (z. B. Restaurants, Aufenthaltsbereiche und Konferenzräume) separat geregelt werden können, wobei der Temperatur-Sollwert für gemeinschaftlich genutzte Räume im Sommer im Kühlbetrieb auf 22 °C oder höher (+/– 2 °C auf Anfrage der Kunden) bzw. im Winter im Heizbetrieb auf 22 °C oder niedriger (+/– 2 °C auf Anfrage der Kunden) einzustellen ist.
Add/View comments (9)






P35
E 09 Energiesparende Beleuchtungstechnik und Leuchtmittel
Im Betrieb müssen Mindestanforderungen einer energiesparenden Beleuchtungstechnik erfüllt werden, wie z.B.
· Einsatz von Energie sparenden Leuchtmitteln wie LED oder Energiesparlampen
· Zeitschaltuhren oder Bewegungsmelder
Leuchtmittel im Einflussbereich des Betriebes genügen der Energieeffizienzklasse A[ii]. Der Ersatz ggf. noch vorhandener nicht effizienter Leuchtmittel ist im Aktionsprogramm mit kurzen Umsetzungsfristen festzuschreiben und bis zur Folgeprüfung nachzuweisen.
a) Zum Zeitpunkt der Vergabe des Umweltzeichens:
i. müssen mindestens 40 % aller Beleuchtungseinrichtungen im Betrieb mindestens der Energieeffizienzklasse A entsprechen;
ii. müssen mindestens 50 % der Beleuchtungseinrichtungen, die aufgrund ihres Standorts voraussichtlich mehr als fünf Stunden täglich beansprucht werden, mindestens der Energieeffizienzklasse A entsprechen.
b) Innerhalb von höchstens zwei Jahren ab dem Zeitpunkt der Vergabe desUmweltzeichens:
i. müssen mindestens 80 % aller Beleuchtungseinrichtungen im Betrieb mindestens der Energieeffizienzklasse A entsprechen;
ii. müssen 100 % der Beleuchtungseinrichtungen, die aufgrund ihres Standorts voraussichtlich mehr als fünf Stunden täglich beansprucht werden, mindestens der Energieeffizienzklasse A entsprechen.
Anmerkung: Die prozentualen Anteile beziehen sich auf die Gesamtzahl der Leuchten, die für den Einsatz energiesparender Leuchtmittel geeignet sind. Die oben genannten Zielvorgaben gelten nicht für Leuchten, deren physische Eigenschaften den Einsatz energiesparender Leuchtmittel nicht zulassen.
c) In allen Zimmern, die während der Gültigkeitsdauer des Umweltzeichens neu errichtet und/oder renoviert werden, sind automatische Systeme (z.B. Sensoren oder Zentralschlüssel/-karten) zu installieren bzw. zu verwenden, die die gesamte Beleuchtung bei Verlassen des Zimmers ausschalten. (Anm: Privatvermieter sind davon ausgenommen.)
Add/View comments (8)






P36
E 10 Heizgeräte und Klimaanlagen /-geräte für Außenbereiche
Heizgeräte oder Klimaanlagen zur Beheizung bzw. Kühlung von Außenbereichen (wie z. B. Raucherecken oder Verzehrbereiche im Freien) dürfen am Betriebsstandort und bei einem Umweltzeichen-Catering sowie bei Green Meetings und Events nicht eingesetzt werden, es sei denn, sie werden mit erneuerbaren Energieträgern (z.B. nichtelektrisch mit Pellets oder elektrisch mit Umweltzeichen-Strom) betrieben.
Ausnahmen gelten für Raucherbereiche ohne Sitzgelegenheiten, soferne die Anlagen in abgeschirmten Bereichen, die eine Abstrahlung einschränken, eingesetzt werden und deren Einsatz zeitlich minimiert wird (z.B. über bedarfsgesteuerte Zeitschaltuhr / Bewegungsmelder).
Add/View comments (5)





P37
E11 Strom aus erneuerbaren Quellen
Der Betrieb muss 100 % seines Strombedarfs über einen individuellen „grünen“ Tarif aus erneuerbaren Energiequellen decken.
Bei vertraglichen Vereinbarungen, die einen sofortigen Tarifwechsel nicht zulassen, ist ein Wechsel in das Aktionsprogramm aufzunehmen und im internen Zwischenaudit bzw. spätestens bei der Folgeprüfung nachzuweisen.
Mindestens 50 % des Stroms müssen aus erneuerbaren Energiequellen stammen.
Auf mindestens zwei Jahre befristete bindende vertragliche Vereinbarungen (z. B. die Vereinbarung von Strafzahlungen) für den Fall, dass ein Wechsel zu einem anderen Energieversorger erfolgt, können als Kriterium dafür betrachtet werden, dass „kein Zugang“ zu einem Markt gegeben ist, der Strom aus erneuerbaren Energiequellen anbietet.
Add/View comments (6)






P38
E 12 Schwimmbäder im Außenbereich (gilt nur für BEH und PRI)
Bei beheizten Schwimmbädern und Whirlpools im Außenbereich muss in der Nacht sowie in nicht benutzten Zeiten (länger als einen Tag) eine Abdeckung erfolgen, um die Verdunstung des Wassers zu mindern.
Add comment
P39
2. Energie (E) - SOLL-Kriterien (neue Kriterien/wesentliche Änderungen/Streichungen)
Add/View comment (1)

P40
E 14 Energetische Prüfung von Gebäuden
Der Betrieb bzw. der Betriebsstandort wird alle zwei Jahre einer energetischen Prüfung durch einen unabhängigen Experten unterzogen und setzt mindestens zwei in der Prüfung angeregte Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz um.


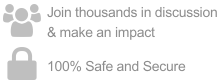


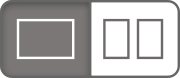

Did you know you can vote on comments? You can also reply directly to people's comments.