It can take a while depending on the size of the document..please wait
Discuto

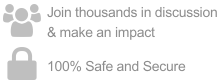
0 days left (ends 31 May)
- Jetzt zur Diskussion und die eigene Meinung einbringen
description
Ziel der Überarbeitung ist es, die derzeitigen Regelungen zu aktualisieren und auf neue Entwicklungen zu reagieren. Die Revision erfolgt im Rahmen eines Multi-Stakeholderprozesses.
Basierend auf den Inputs der online Diskussion im Herbst 2023, die von etlichen Stakeholdern genutzt wurde, und einem Vorschlag des Umweltbundesamtes haben wir einen Entwurf einer überarbeiteten UZ 37 mit folgenden maßgeblichen Änderungen ausgearbeitet.
- geänderte Emissionsgrenzwerte auf Basis des Vorschlags des Umweltbundesamts (UBA), die darauf abzielen, Ziele und Verpflichtungen für Emissionen von Luftschadstoffen bis 2030 und darüber hinaus zu erreichen (neue Richtwerte der WHO, NEC-Richtlinie, die aktuell in Revision befindlichen EU-Luftqualitäts-Richtlinien). Die Präsentation des UBA zur Ratio und Ableitung der Grenzwerte finden Sie auf der u.a. Informationsseite bzw. unter diesem link UBA UZ 37 Vorschläge Emissionsstandards
- Anpassungen an Ökodesign VO für Festbrennstoffkessel und Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräte
Auf Basis der Diskussionsbeiträge der Online Diskussion zu diesem Entwurf werden dann jene Punkte herausgearbeitet, zu denen im Rahmen eines Fachausschusses in Präsenz diskutiert wird. Dieser Fachausschuss wird im 1. Halbjahr 2024 stattfinden.
Je nach Verlauf der Konsensfindung entscheidet sich dann die weitere inhaltliche und zeitliche Vorgangsweise. Die aktuelle Version der Richtlinie UZ 37 Holzheizungen gilt bis 31.12.2024. Abstimmung und Beschluss der überarbeiteten Richtlinie erfolgt im Umweltzeichen-Beirat im Dezember 2024, die Neu-Veröffentlichung der überarbeiteten Richtlinie UZ 37 ist für 1.1.2025 vorgesehen.
Sollten Sie weitere Informationen zur Überarbeitung benötigen, schreiben Sie bitte eine kurze Nachricht an umweltzeichen@vki.at.
LATEST ACTIVITY
LEVEL OF AGREEMENT
MOST DISCUSSED PARAGRAPHS
LATEST COMMENTS
-
 Der Österreichische Biomasse-Verband unterstützt die Bemühungen, die Luftqualität in Österreich zu verbessern. Die Feinstaubemissionen im Hausbrand sind seit 1990 bereits um 40 % zurückgegangen, gleichzeitig hat sich die installierte Leistung von modernen Holzheizungen vervielfacht. Die Verschärfungen für neue Festbrennstoffkessel im Rahmen des UZ halten wir für deutlich überzogen und nicht zielführend. Wir vermissen eine Wirkungsfolgenabschätzung, aus der hervorgeht, wie viel an Emissionen im Jahr durch diese Maßnahmen eingespart werden soll und wie hoch die dafür erforderlichen Kosten sind. Hauptverursacher von Emissionen aus Holzfeuerungen sind Altgeräte ohne automatische Luftzufuhr und damit geregelten Abbrand (Allesbrenner). Hier sollten die seitens der EU vorgeschrieben Überprüfungen stattfinden und die Grenzwerte beim Betrieb der Anlagen angepasst werden. Vorgeschlagen wird hier eine Halbierung der aktuellen CO-Werte der Länder.
Die Analyse der in der GET-Datenbank gelisteten Modelle spiegelt den Markt nicht wieder. Die 10 % der ausgewählten Modelle repräsentieren weniger als 5 % des Absatzes. Es ist schon heute sehr schwierig Betreiber von technisch überholten Altkesseln zum Tausch zu motivieren. Ohne Förderungen – und das wäre die Konsequenz der Verschärfung – ist es decfato unmöglich.
In der GET-Datenbank sind fast nur TOP Geräte gelistet, hier weiter mittels Förderrestriktionen zu selektieren, ist wenig zielführend und für die Hersteller mit massiven wirtschaftlichen Verwerfungen verbunden. Eine so radikale Verschärfung würde einen Bruch der Förderbedingungen bedeuten.
Der Zeitpunkt ist eher unglücklich gewählt, da die Kriterien für die Ökodesign-Richtlinie gerade in Überarbeitung sind. Hier ist festzuhalten, dass die Emissionswerte weder für Kessel für flüssige noch für gasförmige Brennstoffe verschärft wurden.
Sollte eine Verschärfung der Grenzwerte für die Förderung unumgänglich sein, so sollten sich diese an der geltenden deutschen BImSchV orientieren, weiterhin auf mg/MJ und auf den Heizwert bezogen sein. Dies ist erforderlich, da die aktuellen Vorgaben der Länder für den Betrieb ebenfalls so ausgewiesen sind.
Anzumerken ist auch, dass eine Verschärfung der Förderkriterien für Holzkessel einzigartig ist. Die Kriterien für Wärmepumpen wurden vor kurzer Zeit herabgesetzt (55° Vorlauftemperatur anstatt wie bisher 40°), Fernwärme wird auch dann gefördert, wenn sie aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird.
Österreichischer Biomasse-Verband
Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Wien
Der Österreichische Biomasse-Verband unterstützt die Bemühungen, die Luftqualität in Österreich zu verbessern. Die Feinstaubemissionen im Hausbrand sind seit 1990 bereits um 40 % zurückgegangen, gleichzeitig hat sich die installierte Leistung von modernen Holzheizungen vervielfacht. Die Verschärfungen für neue Festbrennstoffkessel im Rahmen des UZ halten wir für deutlich überzogen und nicht zielführend. Wir vermissen eine Wirkungsfolgenabschätzung, aus der hervorgeht, wie viel an Emissionen im Jahr durch diese Maßnahmen eingespart werden soll und wie hoch die dafür erforderlichen Kosten sind. Hauptverursacher von Emissionen aus Holzfeuerungen sind Altgeräte ohne automatische Luftzufuhr und damit geregelten Abbrand (Allesbrenner). Hier sollten die seitens der EU vorgeschrieben Überprüfungen stattfinden und die Grenzwerte beim Betrieb der Anlagen angepasst werden. Vorgeschlagen wird hier eine Halbierung der aktuellen CO-Werte der Länder.
Die Analyse der in der GET-Datenbank gelisteten Modelle spiegelt den Markt nicht wieder. Die 10 % der ausgewählten Modelle repräsentieren weniger als 5 % des Absatzes. Es ist schon heute sehr schwierig Betreiber von technisch überholten Altkesseln zum Tausch zu motivieren. Ohne Förderungen – und das wäre die Konsequenz der Verschärfung – ist es decfato unmöglich.
In der GET-Datenbank sind fast nur TOP Geräte gelistet, hier weiter mittels Förderrestriktionen zu selektieren, ist wenig zielführend und für die Hersteller mit massiven wirtschaftlichen Verwerfungen verbunden. Eine so radikale Verschärfung würde einen Bruch der Förderbedingungen bedeuten.
Der Zeitpunkt ist eher unglücklich gewählt, da die Kriterien für die Ökodesign-Richtlinie gerade in Überarbeitung sind. Hier ist festzuhalten, dass die Emissionswerte weder für Kessel für flüssige noch für gasförmige Brennstoffe verschärft wurden.
Sollte eine Verschärfung der Grenzwerte für die Förderung unumgänglich sein, so sollten sich diese an der geltenden deutschen BImSchV orientieren, weiterhin auf mg/MJ und auf den Heizwert bezogen sein. Dies ist erforderlich, da die aktuellen Vorgaben der Länder für den Betrieb ebenfalls so ausgewiesen sind.
Anzumerken ist auch, dass eine Verschärfung der Förderkriterien für Holzkessel einzigartig ist. Die Kriterien für Wärmepumpen wurden vor kurzer Zeit herabgesetzt (55° Vorlauftemperatur anstatt wie bisher 40°), Fernwärme wird auch dann gefördert, wenn sie aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird.
Österreichischer Biomasse-Verband
Franz-Josefs-Kai 13, 1010 Wien
-
 Stellungnahme der österreichischen Rauchfangkehrer zur Überarbeitung des UZ 37 in Österreich
Wir erkennen die neuen Grenzwerte der WHO vollinhaltlich an und unterstützen die Bemühungen Österreichs, die Luftqualität entsprechend zu verbessern. Dennoch halten wir die Verschärfungen für neue Holzkessel im Rahmen des UZ für deutlich überzogen und nicht zielführend.
Fehlende Wirkungsfolgenabschätzung
Es fehlt eine umfassende Wirkungsfolgenabschätzung, die darlegt, wie viele Emissionen im Jahr durch diese Maßnahmen eingespart werden sollen und welche Kosten zur Zielerreichung in Bezug auf Herstellung, Wartung erforderlich sind. Ohne diese Daten bleibt unklar, ob die geplanten Maßnahmen tatsächlich einen signifikanten Beitrag zur Emissionsreduktion leisten können.
Hauptverursacher: Altgeräte
Die Hauptverursacher von Emissionen in Holzfeuerungen sind überwiegend bis ausschließlich Altgeräte ohne automatische Luftzufuhr und geregelten Abbrand. Hier sollten die von der EU vorgeschriebenen Überprüfungen stattfinden und die Grenzwerte beim Betrieb der Anlagen angepasst werden. Wir schlagen eine Halbierung der aktuellen maximalen CO-Werte der Länder vor, um die Emissionen effizienter zu reduzieren.
Ungenügende Marktanalyse
Die Analyse der in der GET-Datenbank gelisteten Modelle spiegelt den Markt nicht wider. Die 10 % der ausgewählten Modelle repräsentieren weniger als 5 % des Absatzes. Es ist bereits heute sehr schwierig, Betreiber von technisch überholten Altkesseln zum Tausch zu motivieren. Ohne massive Förderungen – und das wäre die Konsequenz der Verschärfung – ist es de facto unmöglich.
Förderrestriktionen und wirtschaftliche Auswirkungen
In der GET-Datenbank sind fast nur TOP-Geräte gelistet. Weiter mittels Förderrestriktionen zu selektieren, wäre wenig zielführend und für die Hersteller mit massiven wirtschaftlichen Verwerfungen verbunden. Unserer Einschätzung nach würde eine solche radikale Verschärfung einen Bruch der Förderbedingungen bedeuten.
Ungünstiger Zeitpunkt der Verschärfung
Der Zeitpunkt der Verschärfung ist unglücklich gewählt, da die Kriterien für die ErP-Verordnung gerade in Überarbeitung sind. Hier sei festgehalten, dass die Emissionswerte weder für Kessel für flüssige noch für gasförmige Brennstoffe verschärft wurden.
Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen
Die über die letzten Jahre erfolgten Verschärfung der Förderkriterien für Holzkessel sindt einzigartig. Im Vergleich dazu wurden die Kriterien für Wärmepumpen vor kurzer Zeit herabgesetzt (55° Vorlauftemperatur anstatt wie bisher 40°). Fernwärme wird auch dann gefördert, wenn sie mit fossilen Brennstoffen (inkl. Heizöl schwer) hergestellt wird.
Abschließend möchten wir betonen, dass wir die Verbesserung der Luftqualität unterstützen, jedoch eine ausgewogene und realistische Herangehensweise bei der Umsetzung von Maßnahmen für notwendig halten.
Stellungnahme der österreichischen Rauchfangkehrer zur Überarbeitung des UZ 37 in Österreich
Wir erkennen die neuen Grenzwerte der WHO vollinhaltlich an und unterstützen die Bemühungen Österreichs, die Luftqualität entsprechend zu verbessern. Dennoch halten wir die Verschärfungen für neue Holzkessel im Rahmen des UZ für deutlich überzogen und nicht zielführend.
Fehlende Wirkungsfolgenabschätzung
Es fehlt eine umfassende Wirkungsfolgenabschätzung, die darlegt, wie viele Emissionen im Jahr durch diese Maßnahmen eingespart werden sollen und welche Kosten zur Zielerreichung in Bezug auf Herstellung, Wartung erforderlich sind. Ohne diese Daten bleibt unklar, ob die geplanten Maßnahmen tatsächlich einen signifikanten Beitrag zur Emissionsreduktion leisten können.
Hauptverursacher: Altgeräte
Die Hauptverursacher von Emissionen in Holzfeuerungen sind überwiegend bis ausschließlich Altgeräte ohne automatische Luftzufuhr und geregelten Abbrand. Hier sollten die von der EU vorgeschriebenen Überprüfungen stattfinden und die Grenzwerte beim Betrieb der Anlagen angepasst werden. Wir schlagen eine Halbierung der aktuellen maximalen CO-Werte der Länder vor, um die Emissionen effizienter zu reduzieren.
Ungenügende Marktanalyse
Die Analyse der in der GET-Datenbank gelisteten Modelle spiegelt den Markt nicht wider. Die 10 % der ausgewählten Modelle repräsentieren weniger als 5 % des Absatzes. Es ist bereits heute sehr schwierig, Betreiber von technisch überholten Altkesseln zum Tausch zu motivieren. Ohne massive Förderungen – und das wäre die Konsequenz der Verschärfung – ist es de facto unmöglich.
Förderrestriktionen und wirtschaftliche Auswirkungen
In der GET-Datenbank sind fast nur TOP-Geräte gelistet. Weiter mittels Förderrestriktionen zu selektieren, wäre wenig zielführend und für die Hersteller mit massiven wirtschaftlichen Verwerfungen verbunden. Unserer Einschätzung nach würde eine solche radikale Verschärfung einen Bruch der Förderbedingungen bedeuten.
Ungünstiger Zeitpunkt der Verschärfung
Der Zeitpunkt der Verschärfung ist unglücklich gewählt, da die Kriterien für die ErP-Verordnung gerade in Überarbeitung sind. Hier sei festgehalten, dass die Emissionswerte weder für Kessel für flüssige noch für gasförmige Brennstoffe verschärft wurden.
Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen
Die über die letzten Jahre erfolgten Verschärfung der Förderkriterien für Holzkessel sindt einzigartig. Im Vergleich dazu wurden die Kriterien für Wärmepumpen vor kurzer Zeit herabgesetzt (55° Vorlauftemperatur anstatt wie bisher 40°). Fernwärme wird auch dann gefördert, wenn sie mit fossilen Brennstoffen (inkl. Heizöl schwer) hergestellt wird.
Abschließend möchten wir betonen, dass wir die Verbesserung der Luftqualität unterstützen, jedoch eine ausgewogene und realistische Herangehensweise bei der Umsetzung von Maßnahmen für notwendig halten.
-
 Laut der Österreichischen Luftschadstoffinventur stammt bei Kleinfeuerungen der größte Anteil der Feinstaubemissionen mit einem Partikeldurchmesser kleiner als 10 μm (PM10) aus sogenannten Allesbrennern, einer veralteten Bauform von Scheitholzkesseln. Diese verursachen 2/3 der Feinstaubemissionen aus Kleinfeuerungen, das sind 16,8% der gesamten Feinstaubemissionen Österreichs. Das Segment Kleinfeuerungen ist zusammen für ca. ein Viertel der österreichischen Feinstaubemissionen verantwortlich.
Die Grenzwerte für Emissionen nach diesem Vorschlag des UZ37 sind nicht geeignet, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität in Österreich zu erreichen. Sie können im Gegenteil dazu führen, dass die Hauptemissionsquellen im Segment Kleinfeuerungen (vgl. https://best-research.eu/webroot/files/file/Factsheet%20Staubemissionen.pdf ), nämlich alte Allesbrenner ohne Verbrennungsregelung und mit händischer Beschickung (diese sind für fast zwei Drittel der Feinstaubemissionen im Segment Kleinanlagen verantwortlich), weiterhin nicht gegen Neuanlagen getauscht werden, weil diese die Förderfähigkeit verlieren würden. Damit würden die Feinstaubemissionen hoch bleiben.
Laut der Österreichischen Luftschadstoffinventur stammt bei Kleinfeuerungen der größte Anteil der Feinstaubemissionen mit einem Partikeldurchmesser kleiner als 10 μm (PM10) aus sogenannten Allesbrennern, einer veralteten Bauform von Scheitholzkesseln. Diese verursachen 2/3 der Feinstaubemissionen aus Kleinfeuerungen, das sind 16,8% der gesamten Feinstaubemissionen Österreichs. Das Segment Kleinfeuerungen ist zusammen für ca. ein Viertel der österreichischen Feinstaubemissionen verantwortlich.
Die Grenzwerte für Emissionen nach diesem Vorschlag des UZ37 sind nicht geeignet, einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität in Österreich zu erreichen. Sie können im Gegenteil dazu führen, dass die Hauptemissionsquellen im Segment Kleinfeuerungen (vgl. https://best-research.eu/webroot/files/file/Factsheet%20Staubemissionen.pdf ), nämlich alte Allesbrenner ohne Verbrennungsregelung und mit händischer Beschickung (diese sind für fast zwei Drittel der Feinstaubemissionen im Segment Kleinanlagen verantwortlich), weiterhin nicht gegen Neuanlagen getauscht werden, weil diese die Förderfähigkeit verlieren würden. Damit würden die Feinstaubemissionen hoch bleiben.
-
 Die Bundesländer, als für Heiznganlagen zuständige Körperschaft, weisen in Ihren Rechtsnormen unverändert mg/MJ aus. Da es für den Bürger sehr verwirrend ist seine Bestandswerte umzurechnen sollte die Einheiten gleich. Ser unterchiedliche Sauerstoffbezug für unterchiedliche Energieträger bzw. Systeme führt regelmäßig zu Verwirrung.
Die Bundesländer, als für Heiznganlagen zuständige Körperschaft, weisen in Ihren Rechtsnormen unverändert mg/MJ aus. Da es für den Bürger sehr verwirrend ist seine Bestandswerte umzurechnen sollte die Einheiten gleich. Ser unterchiedliche Sauerstoffbezug für unterchiedliche Energieträger bzw. Systeme führt regelmäßig zu Verwirrung. -
 Wir anerkennen die neuen Grenzwerte der WHO und unterstützen die Bemühungen Österreichs die Luftqualität entsprechen zu verbessern.
Die Verschärfungen für neue Holzkessel im Rahmen des UZ halten für deutlich überzogen und nicht zielführend.
Wir vermissen ein Wirkungsfolgenabschätzung, aus der hervorgeht, wie viel an Emissionen im Jahr durch diese Maßnahmen eingespart werden sollen und wie hoch die dafür erforderlichen Kosten sind.
Hauptverursacher von Emissionen Holzfeuerungen sind allerdings Altgeräte ohne automatische Luftzufuhr und damit geregelten Abbrand. Hier sollte die seitens der EU vorgeschrieben Überprüfungen stattfinden und die Grenzwerte beim Betrieb der Anlagen angepasst werden. Vorgeschlagen wird hier eine Halbierung der aktuellen CO Werte der Länder.
Wir anerkennen die neuen Grenzwerte der WHO und unterstützen die Bemühungen Österreichs die Luftqualität entsprechen zu verbessern.
Die Verschärfungen für neue Holzkessel im Rahmen des UZ halten für deutlich überzogen und nicht zielführend.
Wir vermissen ein Wirkungsfolgenabschätzung, aus der hervorgeht, wie viel an Emissionen im Jahr durch diese Maßnahmen eingespart werden sollen und wie hoch die dafür erforderlichen Kosten sind.
Hauptverursacher von Emissionen Holzfeuerungen sind allerdings Altgeräte ohne automatische Luftzufuhr und damit geregelten Abbrand. Hier sollte die seitens der EU vorgeschrieben Überprüfungen stattfinden und die Grenzwerte beim Betrieb der Anlagen angepasst werden. Vorgeschlagen wird hier eine Halbierung der aktuellen CO Werte der Länder. -
 Stellungnahme der Firma ETA Heiztechnik GmbH - zusätlich zum Mail an Herrn Kornherr
Bei Emissionsanforderungen (nach mg/Nm³) muss unbedingt auch auf den entsprechenden Sauerstoff-Bezug verweisen werden, um etwaige Missverständnisse vorzubeugen.
Sollten Verschärfung von Grenzwerten für die Förderung von Holzheizsystemen unumgänglich sein, sollten man sich hier an die derzeit geltenden deutschen Emissionsvorschriften, welche in der 1.BImSchV geregelt sind, orientieren.
Diese stellt seit Jahren die Benchmark für alle Biomassekesselhersteller dar und orientier sich an die Grenze des machbaren.
Solange die Emissionsanforderungen für Öfen nicht an die von Festbrennstoffkessel angepasst werden, ist eine Verbesserung der umwelttechnische Gesamtsituation nicht realistisch.
Hauptverursacher von Emissionen bei Holzfeuerungen sind Altgeräte ohne ausreichende Regelungstechnik und ungeregelten Abbrand. Weiters ist anzumerken, dass die Kriterien für Wärmepumpen kürzlich gesenkt wurden und Fernwärme nach wie vor gefördert wird auch wenn sie mit fossilen Brennstoffen erzeugt wird.
Eine Anpassung von Emissionswerten für flüssige und gasförmige Brennstoffe ist auch nicht angedacht – warum eigentlich?
Im Sinne der Umwelt sollte mit einer Überarbeitung kein Nachteil für einen klimaneutralen Biomassekessel, welcher über eine hocheffiziente Feuerungsregelung verfügt, entstehen.
Dies ist in Deutschland leider zu spät erkannt worden und man hat damit der Energiewende einen Bärendienst erwiesen und der Öl- und Gaskessel hat in 2023 wieder eine Renaissance erfahren. Wir glauben dass dies unbedingt verhindert werden muss und die bereits extrem gute Technik von österreichischen Biomassekesseln vorangetrieben werden soll damit die gesetzten Klimaziele erreicht werden können.
DI Ferdinand Tischler
GF ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1
4716 Hofkirchen
Stellungnahme der Firma ETA Heiztechnik GmbH - zusätlich zum Mail an Herrn Kornherr
Bei Emissionsanforderungen (nach mg/Nm³) muss unbedingt auch auf den entsprechenden Sauerstoff-Bezug verweisen werden, um etwaige Missverständnisse vorzubeugen.
Sollten Verschärfung von Grenzwerten für die Förderung von Holzheizsystemen unumgänglich sein, sollten man sich hier an die derzeit geltenden deutschen Emissionsvorschriften, welche in der 1.BImSchV geregelt sind, orientieren.
Diese stellt seit Jahren die Benchmark für alle Biomassekesselhersteller dar und orientier sich an die Grenze des machbaren.
Solange die Emissionsanforderungen für Öfen nicht an die von Festbrennstoffkessel angepasst werden, ist eine Verbesserung der umwelttechnische Gesamtsituation nicht realistisch.
Hauptverursacher von Emissionen bei Holzfeuerungen sind Altgeräte ohne ausreichende Regelungstechnik und ungeregelten Abbrand. Weiters ist anzumerken, dass die Kriterien für Wärmepumpen kürzlich gesenkt wurden und Fernwärme nach wie vor gefördert wird auch wenn sie mit fossilen Brennstoffen erzeugt wird.
Eine Anpassung von Emissionswerten für flüssige und gasförmige Brennstoffe ist auch nicht angedacht – warum eigentlich?
Im Sinne der Umwelt sollte mit einer Überarbeitung kein Nachteil für einen klimaneutralen Biomassekessel, welcher über eine hocheffiziente Feuerungsregelung verfügt, entstehen.
Dies ist in Deutschland leider zu spät erkannt worden und man hat damit der Energiewende einen Bärendienst erwiesen und der Öl- und Gaskessel hat in 2023 wieder eine Renaissance erfahren. Wir glauben dass dies unbedingt verhindert werden muss und die bereits extrem gute Technik von österreichischen Biomassekesseln vorangetrieben werden soll damit die gesetzten Klimaziele erreicht werden können.
DI Ferdinand Tischler
GF ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1
4716 Hofkirchen -
 Stellungnahme der Fa. Windhager-BHT zu der vorgeschlagenen Überarbeitung der Grundlagen für das Umweltzeichen UZ-37:
Wir als Windhager begrüßen die Anstrengungen des UBA zur Verbesserung der Luftqualität in Österreich. Wir sind uns auch als Hersteller von Biomasse-Kesseln der Verantwortung bewusst, sowohl für die Luftgüte als auch für den Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energieträger einen wesentlichen Beitrag zu leisten.
Dieses Bewusstsein ist daran zu erkennen, dass wir in den letzten Jahren massive Anstrengungen unternommen haben, die Emissionen unserer Produkte dramatisch zu reduzieren und in weiten Bereichen nahe an die Nachweisgrenze zu bringen. Insbesondere trifft das für die Staubemissionen zu, die sowohl bei unseren Produkten als auch insgesamt in der Branche nahe gegen null gedrückt wurden. Als besonderes Beispiel ist dabei unser Hackschnitzelkessel PuroWIN zu nennen, bei dem durch technologische Weiterentwicklung die Emissionsreduzierung besonders ausgeprägt ist.
In diesem Zusammenhang müssen wir aber auch anmerken, dass die Verbesserung der Luftgüte nicht nur an einzelnen technologischen Aspekten festzumachen ist. Vielmehr ist dieser Prozess ein Zusammenspiel von mehreren Maßnahmen. Dabei ist der Austausch von veralteten Heizkessel gegen moderne Technologien aus unserer Sicht der größte Einflussfaktor, damit schnell maßgebliche Effekte erreicht werden können. Leider erkennen wir aktuell weder in der Förderpolitik noch in den vorgeschlagenen Überarbeitungen wesentliche Schritte in diese Richtung. Durch eine dramatische Verschärfung der Anforderungen werden die Geräte in der Anschaffung wesentlich teurer, was viele Endkunden vom Tausch der alten Technologie abhält. Da beim Tausch von Biomasse gegen Biomasse derzeit auch keine Förderungen in Anspruch genommen werden können, muss der Endkunde die ohnehin schon beträchtlichen Umstellungskosten und den Mehraufwand selbst tragen. Hier wirken erhöhte Anforderungen an die Neugeräte für die Luftgüte kontraproduktiv.
Stellt man einen Vergleich an, welche Staubmengen durch die vorgeschlagene Verschärfung wirklich vermieden werden, kommt man sicherlich zu dem Schluss, dass diese Einsparung in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Bei einer bereits ausgereiften Technik noch einmal 90% der Geräte aus der Förderung und damit de facto aus dem Markt zu drängen, bringt für die Luftqualität nur marginale Fortschritte. Die bereits jetzt in der get-Datenbank gelisteten Geräte sind schon auf einem hohen technischen Standard mit niedrigen Emissionen, daher tragen sie auch jetzt schon das Umweltzeichen.
Eine weitere Einschränkung des Angebotes durch eine Auswahl von 10% der angebotenen Typen bedeutet eine noch drastischere Einschränkung des Marktes, da die technologisch hochstehenden Produkte durch den höheren Preis in deutlich geringen Stückzahlen verkauft werden. Auch eine Reduzierung des Angebotes reduziert die Attraktivität des Heizungstausches für den Endkunden.
Wir stehen zu unserer Verantwortung und können eine Verschärfung der Anforderungen des Umweltzeichens in einem vernünftigen Rahmen gegenüber dem bisherigen Status unterstützen. Eine Angleichung an die Fördergrundlagen in Deutschland (das ist das Niveau der 1.BimschV) wäre ein sinnvolles Maß, zumal die Märkte von Anforderungen und Förderbedingungen durchaus vergleichbar sind. Eine entsprechende Berücksichtigung und Angleichung der Einheiten für die Grenzwerte müsste entsprechend erfolgen.
Ein Inkrafttreten, wie in der Präsentation vorgeschlagen, zum 01.01.2025, ist aus unser Sicht ein extrem ungeeigneter Zeitpunkt. Warum?
- Zum Ersten würde damit ein Bruch in den Förderbedingungen der Bundesförderung „Raus aus Öl und Gas“ erfolgen. Das Umweltzeichen ist ja die Grundlage der Förderung. Eine Umstellung in der laufenden Förderperiode würde einerseits großen administrativen Aufwand verursachen, andererseits die tauschwilligen Endkunden wieder verunsichern. Welche Geräte jetzt wirklich förderfähig sind, müsste erst wieder aufwändig durch die Hersteller kommuniziert werden.
- Zum Zweiten wird auf europäischer Ebene gerade die Anpassung der Ökodesign-Richtlinie verhandelt, die ebenfalls die Grenzwerte für diese Gerätekategorie festlegt. Auch hier ist ein wesentliches Ziel die Verbesserung der Luftqualität und die Reduzierung der Emissionen. Daher sollte die nationale Regelung auf die europäischen Vorgaben abgestimmt werden, um österreichische Sonderwege zu vermeiden.
- Zum Dritten ist diese Regelung auch im Kontext mit anderen Wärmeerzeugern zu sehen: Im Bereich der Kaminöfen sind keine Verschärfungen geplant, auch hier gibt es ein Potential zur Verringerung der Emissionen. Im Bereich der Wärmepumpen wurden die Anforderungen für die Förderung erst vor kurzem gelockert, und die Wirkung der Fernwärme auf die Emissionen wird in den Ausbauplänen meist gar nicht berücksichtigt (Weiterverwendung von fossilen Brennstoffen). Insofern wäre eine Schlechterstellung der Biomasse innerhalb der laufenden Förderperiode ein weiteres Hindernis für die Wärmewende.
- Zum Vierten bleibt den Herstellern extrem wenig Zeit, um auf die geänderten Anforderungen zu reagieren und die Geräte entsprechend weiterzuentwickeln.
Wir schlagen daher vor, die Entscheidung der EU für die Ökodesign-Richtlinie abzuwarten, die neuen Grenzwerte an diesen Entscheidungen auszurichten und dann mit einer entsprechenden Vorlaufzeit in Kraft zu setzen.
Mit freundlichen Grüßen
DI Gerhard GERG
BHT – Best Heating Technology - GmbH
Anton-Windhager-Straße 20
A-5201 Seekirchen am Wallersee
T +43 6212 2341 290
M +43 664 78 00 66 54
gerhard.gerg@windhager.com
Stellungnahme der Fa. Windhager-BHT zu der vorgeschlagenen Überarbeitung der Grundlagen für das Umweltzeichen UZ-37:
Wir als Windhager begrüßen die Anstrengungen des UBA zur Verbesserung der Luftqualität in Österreich. Wir sind uns auch als Hersteller von Biomasse-Kesseln der Verantwortung bewusst, sowohl für die Luftgüte als auch für den Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energieträger einen wesentlichen Beitrag zu leisten.
Dieses Bewusstsein ist daran zu erkennen, dass wir in den letzten Jahren massive Anstrengungen unternommen haben, die Emissionen unserer Produkte dramatisch zu reduzieren und in weiten Bereichen nahe an die Nachweisgrenze zu bringen. Insbesondere trifft das für die Staubemissionen zu, die sowohl bei unseren Produkten als auch insgesamt in der Branche nahe gegen null gedrückt wurden. Als besonderes Beispiel ist dabei unser Hackschnitzelkessel PuroWIN zu nennen, bei dem durch technologische Weiterentwicklung die Emissionsreduzierung besonders ausgeprägt ist.
In diesem Zusammenhang müssen wir aber auch anmerken, dass die Verbesserung der Luftgüte nicht nur an einzelnen technologischen Aspekten festzumachen ist. Vielmehr ist dieser Prozess ein Zusammenspiel von mehreren Maßnahmen. Dabei ist der Austausch von veralteten Heizkessel gegen moderne Technologien aus unserer Sicht der größte Einflussfaktor, damit schnell maßgebliche Effekte erreicht werden können. Leider erkennen wir aktuell weder in der Förderpolitik noch in den vorgeschlagenen Überarbeitungen wesentliche Schritte in diese Richtung. Durch eine dramatische Verschärfung der Anforderungen werden die Geräte in der Anschaffung wesentlich teurer, was viele Endkunden vom Tausch der alten Technologie abhält. Da beim Tausch von Biomasse gegen Biomasse derzeit auch keine Förderungen in Anspruch genommen werden können, muss der Endkunde die ohnehin schon beträchtlichen Umstellungskosten und den Mehraufwand selbst tragen. Hier wirken erhöhte Anforderungen an die Neugeräte für die Luftgüte kontraproduktiv.
Stellt man einen Vergleich an, welche Staubmengen durch die vorgeschlagene Verschärfung wirklich vermieden werden, kommt man sicherlich zu dem Schluss, dass diese Einsparung in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Bei einer bereits ausgereiften Technik noch einmal 90% der Geräte aus der Förderung und damit de facto aus dem Markt zu drängen, bringt für die Luftqualität nur marginale Fortschritte. Die bereits jetzt in der get-Datenbank gelisteten Geräte sind schon auf einem hohen technischen Standard mit niedrigen Emissionen, daher tragen sie auch jetzt schon das Umweltzeichen.
Eine weitere Einschränkung des Angebotes durch eine Auswahl von 10% der angebotenen Typen bedeutet eine noch drastischere Einschränkung des Marktes, da die technologisch hochstehenden Produkte durch den höheren Preis in deutlich geringen Stückzahlen verkauft werden. Auch eine Reduzierung des Angebotes reduziert die Attraktivität des Heizungstausches für den Endkunden.
Wir stehen zu unserer Verantwortung und können eine Verschärfung der Anforderungen des Umweltzeichens in einem vernünftigen Rahmen gegenüber dem bisherigen Status unterstützen. Eine Angleichung an die Fördergrundlagen in Deutschland (das ist das Niveau der 1.BimschV) wäre ein sinnvolles Maß, zumal die Märkte von Anforderungen und Förderbedingungen durchaus vergleichbar sind. Eine entsprechende Berücksichtigung und Angleichung der Einheiten für die Grenzwerte müsste entsprechend erfolgen.
Ein Inkrafttreten, wie in der Präsentation vorgeschlagen, zum 01.01.2025, ist aus unser Sicht ein extrem ungeeigneter Zeitpunkt. Warum?
- Zum Ersten würde damit ein Bruch in den Förderbedingungen der Bundesförderung „Raus aus Öl und Gas“ erfolgen. Das Umweltzeichen ist ja die Grundlage der Förderung. Eine Umstellung in der laufenden Förderperiode würde einerseits großen administrativen Aufwand verursachen, andererseits die tauschwilligen Endkunden wieder verunsichern. Welche Geräte jetzt wirklich förderfähig sind, müsste erst wieder aufwändig durch die Hersteller kommuniziert werden.
- Zum Zweiten wird auf europäischer Ebene gerade die Anpassung der Ökodesign-Richtlinie verhandelt, die ebenfalls die Grenzwerte für diese Gerätekategorie festlegt. Auch hier ist ein wesentliches Ziel die Verbesserung der Luftqualität und die Reduzierung der Emissionen. Daher sollte die nationale Regelung auf die europäischen Vorgaben abgestimmt werden, um österreichische Sonderwege zu vermeiden.
- Zum Dritten ist diese Regelung auch im Kontext mit anderen Wärmeerzeugern zu sehen: Im Bereich der Kaminöfen sind keine Verschärfungen geplant, auch hier gibt es ein Potential zur Verringerung der Emissionen. Im Bereich der Wärmepumpen wurden die Anforderungen für die Förderung erst vor kurzem gelockert, und die Wirkung der Fernwärme auf die Emissionen wird in den Ausbauplänen meist gar nicht berücksichtigt (Weiterverwendung von fossilen Brennstoffen). Insofern wäre eine Schlechterstellung der Biomasse innerhalb der laufenden Förderperiode ein weiteres Hindernis für die Wärmewende.
- Zum Vierten bleibt den Herstellern extrem wenig Zeit, um auf die geänderten Anforderungen zu reagieren und die Geräte entsprechend weiterzuentwickeln.
Wir schlagen daher vor, die Entscheidung der EU für die Ökodesign-Richtlinie abzuwarten, die neuen Grenzwerte an diesen Entscheidungen auszurichten und dann mit einer entsprechenden Vorlaufzeit in Kraft zu setzen.
Mit freundlichen Grüßen
DI Gerhard GERG
BHT – Best Heating Technology - GmbH
Anton-Windhager-Straße 20
A-5201 Seekirchen am Wallersee
T +43 6212 2341 290
M +43 664 78 00 66 54
gerhard.gerg@windhager.com
-
 Aus unserer Sicht kann die Anforderung "Abstrahlverluste" entfallen, da wir als Kessel-Hersteller sowieso diverse Wirkungsgradanforderungen erfüllen müssen und somit immer die Abstrahlverluste unserer Geräte auf ein Kosten-Nutzen-optimiertes Niveau reduzieren. Zudem werden mit der aktuellen Anforderung Geräte mit sehr kleiner Nennleistung (im Bereich von 10kW) stark benachteiligt.
Aus unserer Sicht kann die Anforderung "Abstrahlverluste" entfallen, da wir als Kessel-Hersteller sowieso diverse Wirkungsgradanforderungen erfüllen müssen und somit immer die Abstrahlverluste unserer Geräte auf ein Kosten-Nutzen-optimiertes Niveau reduzieren. Zudem werden mit der aktuellen Anforderung Geräte mit sehr kleiner Nennleistung (im Bereich von 10kW) stark benachteiligt. -
 Kachelöfen geprüft nach ÖNORM B 8303 berücksichtigen als einzige Vertreter der Kategorie Stückholzöfen Kaltstart Emissionen. Dies bildet die Realität deutlich besser ab als die europäischen Prüfnormen für Stückholzöfen und führt durch die verschärfte Prüfmethodik naturgegeben zu höheren Staubemissionen. deshalb fordern wir für Kachelöfen nach EN 15544 (geprüft nach ÖNOM B 8303) eine eigene Kategorie mit eigenen Grenzwerten, die wir wie folgt vorschlagen (mg/m3):
CO 700, OGC 68 (gleich), Staub 35, NOx 150, saisonale Energieeffizienz 71% bzw. Wirkungsgrad 80%.
Der österreichische Gesetzgeber trägt der Unterschiedlichkeit dahingehend Rechnung, dass ortsfest gesetzte Öfen und Herde unter die Technische Richtlinie Heizungsanlagen 2020 fallen. Von der Ökodesign Verordnung 1185/2015 sind diese Produkte nicht umfasst.
Kachelöfen geprüft nach ÖNORM B 8303 berücksichtigen als einzige Vertreter der Kategorie Stückholzöfen Kaltstart Emissionen. Dies bildet die Realität deutlich besser ab als die europäischen Prüfnormen für Stückholzöfen und führt durch die verschärfte Prüfmethodik naturgegeben zu höheren Staubemissionen. deshalb fordern wir für Kachelöfen nach EN 15544 (geprüft nach ÖNOM B 8303) eine eigene Kategorie mit eigenen Grenzwerten, die wir wie folgt vorschlagen (mg/m3):
CO 700, OGC 68 (gleich), Staub 35, NOx 150, saisonale Energieeffizienz 71% bzw. Wirkungsgrad 80%.
Der österreichische Gesetzgeber trägt der Unterschiedlichkeit dahingehend Rechnung, dass ortsfest gesetzte Öfen und Herde unter die Technische Richtlinie Heizungsanlagen 2020 fallen. Von der Ökodesign Verordnung 1185/2015 sind diese Produkte nicht umfasst. -
 In der Online Diskussion im November 2023 wurde in mehreren Kommentaren angemerkt, dass die jährliche Überprüfung für Raumheizgeräte (Kachelöfen, Herde, Kaminöfen, Kamineinsätze,..) nicht erforderlich ist und die nachträgliche Ausstattung mit Messgeräten in Frage gestellt.
Diese Anforderungen beziehen sich auf ein verpflichtendes Angebot und nicht auf eine verpflichtende Durchführung. Die Anforderung zielt auf einen umweltfreundlichen Betrieb an, der wie stets von allen Seiten betont, der wichtigste Aspekt ist, um Emissionen von Holzheizungen zu reduzieren. Es ist daher nicht geplant diese Anforderungen zu verändern, zumal sie schon seit Veröffentlichung der UZ 37 bestehen.
In der Online Diskussion im November 2023 wurde in mehreren Kommentaren angemerkt, dass die jährliche Überprüfung für Raumheizgeräte (Kachelöfen, Herde, Kaminöfen, Kamineinsätze,..) nicht erforderlich ist und die nachträgliche Ausstattung mit Messgeräten in Frage gestellt.
Diese Anforderungen beziehen sich auf ein verpflichtendes Angebot und nicht auf eine verpflichtende Durchführung. Die Anforderung zielt auf einen umweltfreundlichen Betrieb an, der wie stets von allen Seiten betont, der wichtigste Aspekt ist, um Emissionen von Holzheizungen zu reduzieren. Es ist daher nicht geplant diese Anforderungen zu verändern, zumal sie schon seit Veröffentlichung der UZ 37 bestehen. -
 Zum Punkt "Wirkungsgrad und Abstrahlverluste" wurde noch kein Änderungsvorschlag in diesen Entwurf aufgenommen.
Jedenfalls sollen die Begriffe an die Ökodesign Richtlinien angepasst und vergleichbar gemacht werden. Dies betrifft insbesondere den Begriff "Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad" (Ökodesign RL) versuch "Wirkungsgrad" (UZ 37). Auch die Berechnung ist an die Ökodesign RL anzupassen. Darüber hinaus ist zu diskutieren, ob die Anforderung "Abstrahlverluste" bestehen bleiben soll.
Wir ersuchen im Kommentare zu diesem Punkt.
Zum Punkt "Wirkungsgrad und Abstrahlverluste" wurde noch kein Änderungsvorschlag in diesen Entwurf aufgenommen.
Jedenfalls sollen die Begriffe an die Ökodesign Richtlinien angepasst und vergleichbar gemacht werden. Dies betrifft insbesondere den Begriff "Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad" (Ökodesign RL) versuch "Wirkungsgrad" (UZ 37). Auch die Berechnung ist an die Ökodesign RL anzupassen. Darüber hinaus ist zu diskutieren, ob die Anforderung "Abstrahlverluste" bestehen bleiben soll.
Wir ersuchen im Kommentare zu diesem Punkt. -
 ad Prüfnormen:
Die neuen Normen der Serie EN 16510 gelten 3 Jahre parallel zu den angeführten Normen, danach aus heutiger Sicht nur mehr jene der Serie EN 16510.
In der online Diskussion wurden für Festbrennstoffkessel und für Kachelöfen keine alternativen Normen der Serie EN 16510 vorgeschlagen.
ÖNORM EN 16510-2-4, Teil 4 gilt für "Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe und Heizkessel für feste Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung bis 50kW.
ÖNORM EN 16510-2 "ist auch anzuwenden für Kachelofen- und Putzofen-Heizeinsätze mit einer Nennwärmeleistung bis 15 kW".
Diese beiden Normenteile wurden daher ebenfalls als Alternativen eingefügt. Bitte um Ihre Kommentare, falls und warum diese ggf. nicht anzuwenden sind.
ad Prüfnormen:
Die neuen Normen der Serie EN 16510 gelten 3 Jahre parallel zu den angeführten Normen, danach aus heutiger Sicht nur mehr jene der Serie EN 16510.
In der online Diskussion wurden für Festbrennstoffkessel und für Kachelöfen keine alternativen Normen der Serie EN 16510 vorgeschlagen.
ÖNORM EN 16510-2-4, Teil 4 gilt für "Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe und Heizkessel für feste Brennstoffe mit einer Nennwärmeleistung bis 50kW.
ÖNORM EN 16510-2 "ist auch anzuwenden für Kachelofen- und Putzofen-Heizeinsätze mit einer Nennwärmeleistung bis 15 kW".
Diese beiden Normenteile wurden daher ebenfalls als Alternativen eingefügt. Bitte um Ihre Kommentare, falls und warum diese ggf. nicht anzuwenden sind.
-
 In der ersten online Diskussion wurde argumentiert, die Norm zur Lagerung von Pellets zu streichen, da diese nicht Gegenstand dieser UZ-Richtlinie sind. Da es unter diesem Punkt darum geht, verpflichtende Information bereitzustellen, die eine möglichst geringe und gleichmäßige Emissionen im Betrieb ermöglichen, ist ein verpflichtender Hinweis auf die Lagerung durchaus sinnvoll. Zu diskutieren ist, ob der Pkt. 2.1 nicht nach hinten zum Punkt 3.2 "Dienstleistungen des Hersteller" oder Punkt 4.2 "Bedienungsanleitung" verschoben werden sollte, da dort ebenfalls Informationen zu den Brennstoffen gefordert werden.
In der ersten online Diskussion wurde argumentiert, die Norm zur Lagerung von Pellets zu streichen, da diese nicht Gegenstand dieser UZ-Richtlinie sind. Da es unter diesem Punkt darum geht, verpflichtende Information bereitzustellen, die eine möglichst geringe und gleichmäßige Emissionen im Betrieb ermöglichen, ist ein verpflichtender Hinweis auf die Lagerung durchaus sinnvoll. Zu diskutieren ist, ob der Pkt. 2.1 nicht nach hinten zum Punkt 3.2 "Dienstleistungen des Hersteller" oder Punkt 4.2 "Bedienungsanleitung" verschoben werden sollte, da dort ebenfalls Informationen zu den Brennstoffen gefordert werden.
MOST ACTIVE USERS
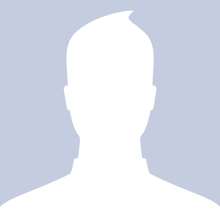
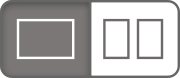

P1
1. Produktgruppendefinition
Diese Richtlinie gilt für automatisch oder händisch beschickte
- Festbrennstoffkessel gemäß EU-VO 2015/1189
- Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräte gemäß EU-V 2015/1185
Diese müssen für die Verfeuerung des naturbelassenen Brennstoffs Holz, Hackschnitzel oder Presslinge (Briketts, Pellets) geeignet sein und dürfen eine maximale Nennwärmeleistung von 500 kW aufweisen.
Add/View comments (2)

P2
2. Gesundheits- und Umweltkriterien
2.1. Brennstoff
Um möglichst geringe und gleichmäßige Emissionen im Betrieb zu erreichen sollen nur qualitätsgeprüfte Brennstoffe eingesetzt werden.
Vom Antragsteller müssen, in Abhängigkeit der Feuerung, Angaben zum zulässigen Brennstoff, zu seinen allgemeinen technischen Eigenschaften gemäß ÖNORM EN ISO 17225-1 sowie zu den speziellen Eigenschaften gemäß nachstehenden Regelwerken gemacht werden.
- Stückholz:
Spezifikation/Klassifizierung gemäß ÖNORM EN ISO 17225-5 mit Angaben zu Holzart, Größe, Wassergehalt - Holzpresslinge (Briketts, Pellets)
Qualität bzw. Spezifikation/Klassifizierung gemäß UZ 38 „Brennstoffe aus Biomasse“ oder ÖNORM EN ISO 17225-2 bzw. ÖNORM EN ISO 17225-3
Lieferung und Lagerung gemäß
UZ 38 „Brennstoffe aus Biomasse“ oder ÖNORM EN ISO 20023 - Holzhackgut:
Spezifikation/Klassifizierung gemäß ÖNORM EN ISO 17225-4
Add/View comment (1)

P3
2.2 Prüfung
Prüfung und Bestimmung von Wirkungsgrad (Pkt. 2.3), Emissionen (Pkt. 2.4) und Einhaltung der Gebrauchstauglichkeit (Pkt. 3.1) muss für den beantragten Wärmeerzeuger nach den Anforderungen der jeweils zutreffenden, wie nachstehend angeführten Norm, oder anhand einer gleichwertigen erfolgen. Die Bestimmung darf nur von dafür akkreditierten Prüfanstalten durchgeführt werden.
|
Festbrennstoffkessel |
ÖNORM EN 303-5 bzw.. |
|
Festbrennstoff-Einzelraumheizgerät |
ÖNORM EN 13240 bzw. |
|
Festbrennstoff-Einzelraumheizgerät |
ÖNORM EN 14785 bzw. |
|
Kachelofen |
ÖNORM B 8303 bzw. |
|
Herd für feste Brennstoffe |
ÖNORM EN 12815 bzw. |
|
Kamineinsatz |
ÖNORM EN 13229 bzw. |
|
Speicherfeuerstätte |
ÖNORM EN 15250 bzw. |
Add/View comments (2)


P4
2.3 Wirkungsgrad und Abstrahlverluste
In Abhängigkeit der Produktgruppe muss der Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung zumindest die in Tabelle 1 angeführten Werte erreichen:
Tabelle 1: Wirkungsgrad etaK bei Nennwärmeleistung
|
Beschickung |
Heizkessel |
Raumheizgerät |
|
händisch |
71,3 + 7,7 log PN |
80 |
|
automatisch |
90 |
90 |
PN = Nennwärmeleistung
Bei Heizkessel müssen die Abstrahlverluste über die Oberfläche minimiert sein, nachstehende Werte dürfen nicht überschritten werden.
Tabelle 2: maximale Abstrahlverluste bei Nennwärmeleistung
|
Kessel - Nennwärmleistung [kW] |
maximale Abstrahlverluste [%] |
|
bis 100 |
2,5 |
|
100 bis 500 |
1,5 |
Add/View comments (3)



P5
2.3 Emissionen
Bei Prüfung nach den unter Punkte 2.1 angführten Normen dürfen nachstehende Emissionen nicht überschritten werden.
Entsprechend der Ökodesign Richtlinie sind die Emissionsgrenzwerte in mg/m3 dargestellt und beziehen sich bei Festbrennstoffkessel auf einen gewichteten Mittelwert, der sich aus Voll und Teillastbetrieb zusammensetzt.
ANMERKUNG: Hintergrund, Methode und Ableitung der neu vorgeschlagenen Emissionsgrenzwerde nach Analyse der get-Datenbank finden sich in dieser Präsentation
UBA UZ37 Vorschläge Emissionsstandards
die das Umwelbundesamt am 29.04. im Workshop "Biomasse Luftqualität" vorgestellt und nachfolgend ergänzt hat.
Tabelle 3: Emissionsgrenzwerte in [mg/m3]
|
Parameter |
Festbrennstoffkessel | Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräte |
|
CO |
|
|
|
NOx |
|
|
|
Corg |
|
|
|
Staub (hohes Ambitionsniveau) |
6,2 8,3 12,4 |
9 - 18,1 |
|
Staub (mittleres Ambitionsniveau) |
11 10,4 15 |
10,5 - 19 |
Add/View comments (9)






P6
2.5 Elektrische Leistungsaufnahme
Die elektrische Leistungsaufnahme darf im Dauerbetrieb nachstehende Werte nicht überschreiten:
|
händische Beschickung ≤ 30 kW |
maximal 200 Watt |
|
händische Beschickung > 30 kW |
≤ 0,7% der Nennwärmeleistung |
|
automatische Beschickung: |
≤ 1,5% der Nennwärmeleistung |
Add comment
P7
2. 6 Brandschutz
Die beantragte Feuerungsanlage muss den einschlägigen Brandschutzbestimmungen entsprechen.
Alle für eine Anlagentype erforderlichen Sicherheitseinrichtungen sind hinsichtlich Anordnung, Steuerung, Zusammenwirken und Funktionalität (ausgenommen davon sind rückbrandhemmende Einrichtungen) von einer Prüfstelle zu bewerten.
Add comment
P8
2.7 Pufferspeicher
Wird die Heizungsanlage mit Pufferspeicher ausgestattet, so müssen zum Speicher nachstehende Angaben gemacht werden:
-- empfohlene Speicherart (zB Schichtspeicher)
-- Dämmung Speicher: ein maximaler Wärmeverlustkoeffizient von U ≤ 0,35 W/m²K
-- Mindestdämmstärken bei Leitungen
|
Rohrdimension |
Außenbereich [mm] |
Innenbereich [mm] |
|
DN 15 |
30 |
20 |
|
DN 20, DN 25 |
40 |
30 |
|
DN 32 |
40 |
40 |
|
DN 40 |
50 |
40 |
|
DN 50 |
60 |
50 |
-- Empfehlung der geeigneten Pumpen
-- Möglichkeiten zur bivalenten Betriebsweise: zB Einbindung einer Solaranlage
Add/View comment (1)

P9
2.8 Rohstoffe
Zur Dämmung dürfen keine Stoffe oder Materialien verwendet werden, die unter Einsatz von halogenierten organischen Verbindungen hergestellt werden oder die gemäß Grenzwerteverordnung unter „eindeutig als krebserzeugend“ eingestuft sind.
Halogenierte Kunststoffe dürfen nicht eingesetzt werden.
Add/View comment (1)

P10
2.9. Produktion
Die Produktionsstätte ist jener Ort, wo die Produkte zum überwiegenden Teil hergestellt werden.
-- Behördliche Auflagen und gesetzliche Regelungen, insbesondere die Materien Luft, Wasser, Abfall, Umweltinformation sowie ArbeitnehmerInnenschutz betreffend, sind einzuhalten.
Sowohl für inländische als auch für ausländische Produktionsstätten sind die jeweiligen nationalen Bestimmungen zu erfüllen.
Sofern EU-Regelungen über nationale Bestimmungen hinausgehen, sind jedenfalls die EU-Regelungen einzuhalten.
Der Antragsteller hat die Einhaltung dieser Anforderung zu bestätigen.
-- Ein Abfallwirtschaftskonzept (AWK) gemäß Abfallwirtschaftsgesetz ist vorzulegen.
-- Für Produktionsstätten, die nach EMAS Verordnung registriert sind, gelten die oben genannten Anforderungen als erfüllt.
Existiert für den Produktionsstandort ein nach ÖNORM EN ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem können die Audit-Ergebnisse als Nachweis der Einhaltung der oben genannten Anforderungen herangezogen werden.
Add comment
P11
2.10 Verpackung
Eingesetzte Kunststoffe müssen frei von halogenierten organischen Verbindungen sein.
Inverkehrsetzer von Verpackungen haben diese entweder selbst zurückzunehmen und zu verwerten oder nachweislich an einem Sammel- und Verwertungssystem teilzunehmen. Es gelten die Bestimmungen der Verpackungsverordnung.
Add comment
P12
3. Gebrauchstauglichkeit
3.1 Normprüfung
Es muss der Nachweis erbracht werden, dass alle Anforderungen der jeweils zutreffenden Norm, wie in Pkt. 2.2 "Prüfung" angeführt, oder einer gleichwertigen Norm eingehalten werden.
Werden mehrere Typen einer Baureihe geprüft, ist entsprechend ÖNORM EN 303-5, Pkt. 5.1.4 bzw. ÖNORM EN 16510-1, Anhang G (G.1-G.3) vorzugehen.
Die Typunterschiede müssen im Gutachten angeführt werden, ebenso die Nachweise, dass alle in dieser Richtlinie gestellten Anforderungen eingehalten werden.
Add/View comment (1)

P13
3.2. Dienstleistungen des Herstellers
Der umweltschonende Betrieb einer Holzheizung wird im Wesentlichen durch das Verhalten des Betreibers bestimmt.
Um dieses positiv zu unterstützen, muss der Zeichennutzer zumindest nachstehende Dienstleistungen und Informationen anbieten:
-- Angebot der Erstinbetriebnahme des Wärmeerzeugers durch den Zeichennutzer bzw. Anlagenerrichter.
Erläuterung aller Parameter für eine effiziente, emissionsarme Verbrennung und Betriebsführung (Kundenschulung).
-- Angebot eines zu üblichen Kundendienstzeiten verfügbaren Wartungsdienstes
-- Angebot der jährlichen Überprüfung des Heizgerätes
-- Angebot zur Ausstattung der Anlage mit zusätzlichen Messeinrichtungen
(zB Abgasthermometer, Betriebsstundenzähler)
-- Verfügbarkeit gleichwertiger Ersatzteile für mindestens 10 Jahre
-- Hinweise auf alle relevanten Regelwerke und Normen von Brennstoffqualität, Lager- und Transportlogistik
-- Hinweis, dass bei Planung und Ausführung eines Brennstofflagers für Pellets die Anforderungen der ÖNORM EN ISO 20023 berücksichtigt werden sollen
-- Technische Schulung für Anlagenerrichter und Verkäufer
Add/View comment (1)

P14
3.3. Installationshinweise
Zur Vermeidung fehlerhafter Installationen müssen die schriftlichen und grafischen Unterlagen für den Installateur so gestaltet sein, dass alle notwendigen Informationen verständlich und in der richtigen Reihenfolge angeführt sind.
Weiters müssen zumindest nachstehende Informationen, sofern sie für den beantragten Wärmeerzeuger relevant sind, enthalten sein:
-- Technische Informationen zum Wärmeerzeuger:
Kesselklasse, Abgasanschlussdurchmesser, Abgastemperaturen im Betrieb sowie notwendige Förderdruck, Füllraumabmessungen, Wasserinhalt, wasserseitiger Widerstand, benötigter Kaltwasserdruck, kleinste Rücklauftemperatur
Elektroanschluss, Absicherung und Schaltungen, Zusatzaggregate
-- zum Brennstoff:
Brennstoffart und -stückgröße, maximaler Wassergehalt und Wärmeleistung, Füllgrade und entsprechende Brenndauer
-- Montageanleitung für den schrittweisen Zusammenbau und der notwendigen Prüfungen vor Ort, Aufstellung und Varianten; Hinweise zur Vermeidung von Fehlerquellen, Einbaulage aller Fühler für Regel- und Anzeigegeräte, Einstellbereiche der Regler, korrekte Einstellungen für die Inbetriebnahme
-- Regelung der Wärmeverteilung:
zonenweise Regelung, Zeitsteuerungen, Thermostatventile, etc.
Add comment
P15
3.4. Wartung
Für den Betreiber sind Informationen und Anleitungen für die Überprüfung der einwandfreien Funktion der Anlage zur Verfügung zu stellen.
Diese müssen nach Eigen- und Fremdwartung aufgeteilt sein und zumindest nachstehende Punkte umfassen:
-- Periodische Wartungen während des Heizbetriebs (Intervall, Umfang…)
-- Wöchentliche Kontrollen (zB Sichtkontrolle)
-- Wartung und Kontrollen der Raumaustragung
-- Führen eines Wartungsbuches
-- Wartung durch Anlagenerrichter bzw. geeigneten Wartungsdienst (Intervall, Umfang...)
Add comment
P16
4. Deklaration
4.1. Informationen vor dem Kauf
Die Kunden müssen vor dem Kauf über nachstehende Punkte informiert werden:
-- Abstimmung der Anlagendimensionierung auf die notwendige Energiedienstleistung
-- Für eine ordnungsgemäße Anlagendimensionierung ist ein Fachmann (Hersteller, Anlagenerrichter etc.) beizuziehen
-- Rationelle Anordnung von Heizraum und Brennstofflager sowie die optimale Aufbereitung und Lagerung der Brennstoffe
-- Quellenangabe einschlägiger technischer Normen oder Gesetze für die Anlagendimensionierung
-- wichtigste technische Daten und alle Emissionswerte
-- Hinweis, dass in den Förderrichtlinien der Bundesländer unterschiedliche Anforderungen an Pufferspeicher gestellt werden
Add comment
P17
4.2 Bedienungsanleitung
Die schriftlichen Unterlagen für den Anwender müssen so gestaltet sein, dass die wesentlichen und für die Effizienz des Gesamtsystems notwendigen Parameter verständlich und umweltschutzbezogen dargestellt sind.
Damit der am Prüfstand ausgewiesene hohe Umweltstandard der Biomasse-Feuerung auch im Alltagsbetrieb eingehalten werden kann, muss eine ausführliche Bedienungsanleitung mit nachstehenden Punkten und Angaben dem Benutzer übergeben werden.
Umweltschutz:
-- Deutlicher Hinweis darauf, dass der Benutzer nur unter Einhaltung aller in der Bedienungsanleitung angeführten Anforderungen einen wesentlichen Beitrag zum umweltschonenden Betrieb des Wärmeerzeugers leisten kann.
-- nur zulässigen Brennstoff verwenden
-- keine Verbrennung von Abfall
-- Angaben zum effizienten und umweltschonenden Heizen, siehe auch www.richtigheizen.at
-- Hinweise zur Ascheentsorgung
-- Entsorgungshinweise für die einzelnen Anlagenkomponenten
Angaben zum Brennstoff:
-- zulässige Brennstoffart (maximaler Wassergehalt, Größe...)
-- maximale Füllhöhe
-- Brenndauer bei Nennwärmeleistung für jede zulässige Brennstoffart
-- Energieinhalt einer Brennstofffüllung
-- Deklaration des Prüfbrennstoffs
Inbetriebnahme und Betrieb:
-- richtiges öffnen, beschicken, anfeuern und nachlegen
-- Funktion und Bedienung der Regelung für Voll- und Teillast-Betrieb
-- Hinweise zur Beurteilung der Verbrennungsgüte und des Betriebszustands anhand von visuellen Beobachtungen (Flamme, Ablagerungen, Asche, Abgastemperatur...)
Service und Wartung:
-- Reinigung: Angaben zu Intervallen und notwendiger Geräte
-- Störung: richtiges Verhalten, Fehlersuche und Behebung
-- Wartung: Umfang von Eigen- und Fremdwartung, Intervalle
-- Service-Telefonnummern: Hersteller, Wartungsdienst etc.
zusätzliche Angaben für Heizkessel
-- Hinweise zur Ausführung der nötigen Rücklauf- bzw. Kesselhochhaltung. Empfehlung für Einbau einer Kontrollmöglichkeit (zB Thermometer)
-- Teillastfähigkeit der Kesselregelung
-- Angaben zur Anpassung der Anlage an wechselnden Brennstoff (v.a. bei Hackgutfeuerungen)
Add/View comment (1)

P18
4.3 Typenschild
Das am Heizgerät angebrachte Typenschild muss nachstehende Angaben enthalten:
-- Name und Firmensitz des Herstellers und ggf. Herstellerzeichen
Firmenname und Adresse
Handels- bzw. Typbezeichnung, unter der das Heizgerät vertrieben wird
Hersteller-, Typnummer und Baujahr
Angaben zur zulässigen Brennstoffart und -größe
Nennwärmeleistung und Leistungsbereich in kW für die zulässige Brennstoffart
Elektroanschluss (V, Hz, A) und elektrische Leistungsaufnahme in Watt (wenn vorhanden)
Für Heizkessel müssen zusätzlich nachstehende Angaben gemacht werden:
-- am Typenschild:
Kesselklasse
maximal zulässige Betriestemperatur in °C
maximal zulässiger Betriebsdruck in bar
Wasserinhalt in Liter
Add comment
P19
4.4 Anlagendokumentation
Damit in der Praxis Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Funktionstüchtigkeit des Gesamtsystems annähernd mit den optimierten Bedingungen einer Prüfstandmessung erreicht werden können, kommt der Ausführung der Anlagendokumentation eine wesentliche Bedeutung zu.
Die Anlagendokumentation bzw. das Übergabeprotokoll muss daher zumindest nachstehende Inhalte und Prüfatteste aufweisen:
-- Prüfbericht (gem. jeweiliger Norm) mit folgenden Beilagen:
Bauartzeichnung mit Bild
Beschreibung und Erläuterung aller Angaben auf dem Typenschild
-- Installationsattest mit folgender Aussage:
Der Anlagenerrichter bestätigt, dass die Anlage fachgerecht und den einschlägigen Brandschutzbestimmungen entsprechend errichtet wurde.
Weiters bestätigt er die Konformität der eingebauten technischen Sicherheitseinrichtungen durch Beilage der Prüfzeugnissen.
-- Der Anlagenbetreiber wurde mit der Bedienung der Anlage vertraut gemacht und über die Wirkungsweise und Eigenkontrolle aller Sicherheitseinrichtungen unterrichtet.
Im Zuge der Unterweisung wurde dem Anlagenbetreiber die Bedienungsanleitung übergegeben.
-- Übergabe der Bedienungsanleitung (Anforderungen gem. Punkt 4.2)
-- Übergabe aller technischen Unterlagen
-- Übergabe aller Konformitätszertifikate
-- Übergabe des Inbetriebnahmeprotokolls
-- Anführen aller Service-Nummern (Hersteller, Installateur, Wartung...)
-- Bei gewerblichen Anlagen mit einer Nennwärmeleistung ≥ 100 kW muss auf die wiederkehrende Prüfung gemäß FeuerungsanlagenVO hingewiesen werden.




Did you know you can vote on comments? You can also reply directly to people's comments.